2009 fand es statt, mein erstes BarCamp. Ich hatte keine Ahnung, was das ist, ging aus Neugier hin und kam begeistert wieder raus. Seitdem pflegte ich sozusagen sporadisch Kontakte zu derlei Unkonferenzen. Viel später, im Sommer 2016, stellte sich dann bei Thalia die Frage, wie wir es am besten anstellen, dass sich möglichst viele Mitarbeiter mit der digitalen Transformation auseinandersetzen. Und welche Kultur es eigentlich braucht, damit das geschieht. Schnell war klar, dass eine klassische Weiterbildungsmaßnahme nicht das Richtige war: Wer sollte eigentlich wem erklären, wie “es” geht? Die Bedürfnisse waren sehr unterschiedlich, schon bei Fach-Themen: eCommerce’ler schlafen ein, wenn ihnen jemand Onlinemarketing-Basics erklärt (“Voll krass, was Google heute schon alles weiß, Mensch!”); Filialprofis dagegen rollen die Augen, wenn Dinge wie “Conversion Rate optimieren” wie ein rein technisch-prozessualer Vorgang beschrieben werden, in dem Mitarbeiterverhalten gar nicht vorkommt. Wir brauchten also ein Format, bei dem die Leute VONEINANDER lernen können. Gleichzeitig standen wir vor der Herausforderung, dass vermutlich jeder mit “digitaler Transformation” etwas anderes verbindet – und wir nicht wussten, was. Wo also aufsetzen? Es musste also eine Begegnung her, die eine große Bandbreite des Themas aufgreift. Und bei alledem wollten wir, dass das gewählte Event selbst ein Modell für die Veränderungen ist, die die Digitalisierung mit sich bringt – indem es den Leuten selbstbestimmt die Möglichkeit zum Vernetzen und Lernen bietet.
Also haben wir uns für ein BarCamp entschieden.
Das übergreifende Thema war mit “Digitale Transformation @ Thalia” schnell gefunden; die rustikale Bühne mit den Sitzkissen und der Bierkühlschrank waren für die lockere Atmosphäre sicher hilfreich. Zwei der drei Zentralstandorte konnten per Webmeeting teilnehmen und so ging es mit am Nachmittag mit einem Sessionpitch los: Wer ein Thema beisteuern wollte, konnte sich mit diesem zur Wahl stellen – das Publikum stimmte zu Beginn – im Session Pitch – ab. Es wurden an diesem ersten, für weniger als 3 Stunden angesetzten Testlauf, am Ende drei aus sieben Sessions gewählt. Die Zahl der freiwilligen Besucher lag bei niedlichen 27, aber das war uns lieber als 100 Unfreiwillige, die kritisch zuschauen. Und so haben wir das Ganze in diesem Frühjahr wiederholt. Und zeitlich ausgeweitet. Und die Sessions rund ums virtuelle Whiteboard so gestaltet, dass man von jedem der drei Zentralstandorte teilnehmen konnte. Diesmal zählten wir 72 Teilnehmer und es kamen 8 Sessions mit noch vielfältigeren Themen als beim ersten Mal zustande. Inzwischen habe ich einiges gelernt und mag nun ein kleines Resümee ziehen:
Lerneffekt Nr. 1: Nicht jeder lässt sich gern überraschen.
“Was erwartet mich denn da?” und “Was kommt denn da raus?” waren nur einige der Fragen, die im Vorfeld aus den verschiedensten Ecken kamen. Irgendwie auch verständlich, denn die meisten Kollegen sind es gewohnt, zielorientiert an klaren Aufgabenstellungen zu arbeiten, zum Teil eng getaktet – da bleibt nicht viel Platz für “In die Luft gucken” oder Experimente. Ein freiwilliges Format, das einem zuraunt “Gestalte doch selber mit, wirste schon sehen, was das bringt!” wird da erstmal kritisch beäugt. Sich extra Zeit freischaufeln, ohne zu wissen, ob sich das lohnt, na ich weiß nich. Das zeigte sich dann auch in den verschiedensten Vorschlägen, das Format umzubauen: Ob wir nicht den Sessionplan eine Woche vorher veröffentlichen könnten, dann kann sich jeder auf die Themen einstellen. Oder ob wir nicht schonmal ein paar Themen vorgeben könnten, damit die Orientierung leichter fällt. Es gab auch die Idee, die Sessions stärker auf einen erwartbaren Output zuzuschneiden. Mein schnöder Tipp für alle, die ein BarCamp intern aufziehen wollen: Nicht beirren lassen, sonst ist am Ende nicht mehr das drin, was draufsteht.
Lerneffekt Nr. 2: Organisches Wachstum ist besser, wirklich.
Wir hätten sicher noch mehr trommeln können, oder über die Führungsebenen etwas Druck machen. Vielleicht hätten wir dann sofort viel mehr Teilnehmer gehabt. Aber: Alle BarCamps, die ich kenne, haben klein angefangen – aber dafür mit engagierten Leuten. Wir haben nach dem ersten BarCamp ganz schlicht ein paar Statements eingefangen und in einem Filmchen verwurstelt – zusammen mit den Erzählungen der Teilnehmer war das sicherlich viel authentischer und Neugier auslösender als andere Marketingmittel allein. Das heißt aber nicht, dass man nicht Trommeln sollte: Wir haben beim zweiten Mal mit einem ganz fantastischen kleinen Orga-Team zum Beispiel Plakate erstellt, auf die Interessierte direkt ihre Session-Idee kleben konnten. Und dazu eine Intranetseite angelegt, auf der die einzelnen Beiträge vorab schon gepostet und geliked werden können. Aber den Sessionplan, den haben wir natürlich nicht vorab veröffentlicht.
Lerneffekt Nr. 3: Wer ist eigentlich die kritische Masse?
Das Konzept Freiwilligkeit hat vermutlich einen Haken: Es interessieren sich nicht alle Ebenen für ein solches Experiment. Gerade bei den Führungskräften wird es, insgesamt gesehen, erstmal dünn. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das schlecht oder gut ist – immerhin wirkt sich die Anwesenheit von Führungskräften unterschiedlich auf die Offenheit der Teilnehmer in den Sessions aus. Auf der anderen Seite waren etliche Mitarbeiter positiv überrascht über die offenen Diskussionen, die im Beisein einiger Führungskräfte stattfanden. Es scheint also möglich. Bin gespannt, wie weit “organisches Teilnehmerwachstum” hier geht.
Lerneffekt Nr. 4: Aufgepasst bei der Session-Verteilung!
Ein BarCamp lebt (auch) von der Parallelität der Sessions – niemand kann bei allen dabei sein, man muss sich entscheiden. Wir mussten leider feststellen: Wenn man sie hintereinander plant, graben die großen Sessions den parallel stattfindenden kleineren Sessions die Teilnehmer ab. Eine Lösung dafür könnte sein, die stärkeren Sessions bewusst parallel stattfinden zu lassen, damit sich im nächsten Zeitfenster genug Leute auf die weniger beliebten Themen verteilen. Ich bin mir hier aber noch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist – es soll ja demokratisch ablaufen, das Teilnehmerinteresse bestimmt, wo es langgeht. Aber es sollte für Sessiongeber mit auf den ersten (!) Blick weniger nachgefragten Themen auch nicht demotivierend sein. Vielleicht hat ja der ein- oder andere Leser hier schon mehr Erfahrungen gemacht und einen Tipp?
Lerneffekt Nr. 5: Standortübergreifende Sessions sind kein Hexenwerk.
Beim zweiten Mal haben wir auch in Sachen Technik dazugelernt: Wir haben uns Profi-Kameras geliehen und nicht nur für die Sessions an sich, sondern auch für den Session-Pitch eine virtuelle Pinwand genutzt. Den größten Unterschied in den Sessions machte tatsächlich der optische Zoom der Kameras, kein Scherz: Nur wenn man alle Beteiligten gut erkennen kann, entsteht ein lebendiges Zusammenarbeits-Gefühl. Die virtuellen Pinwände haben allerdings auch dabei geholfen, die Konzentration auf das übergreifende Arbeiten zu lenken – das hätte mit je einem Flipchart an jedem Standort nicht geklappt. Übrigens kenne ich inzwischen auch das Fachvokabular dazu: “Hybrid-Event”. Klingt schick, nä?
Lerneffekt Nr. 6: Fortsetzungen passieren nicht automatisch.
Mein Traum wäre nun noch, dass sich Gruppen bilden, die an den Session-Themen weiterarbeiten wollen. Im Einzelnen ist das schon der Fall, vor allem natürlich dann, wenn sich sowieso Themenverantwortliche mit “ihrem” Thema für eine Session angeboten haben. Bei den anderen Themen reicht das Intranet, auf dem wir die Session-Dokus veröffentlicht haben, nicht aus. Kommt Zeit, kommt Rat – ich werde berichten.
Und ihr/Sie so? Wer hat eigene Erfahrungen mit BarCamps als internes Format? Würde mich sehr über Kommentare, gerade auch von anderen Unternehmen, freuen!



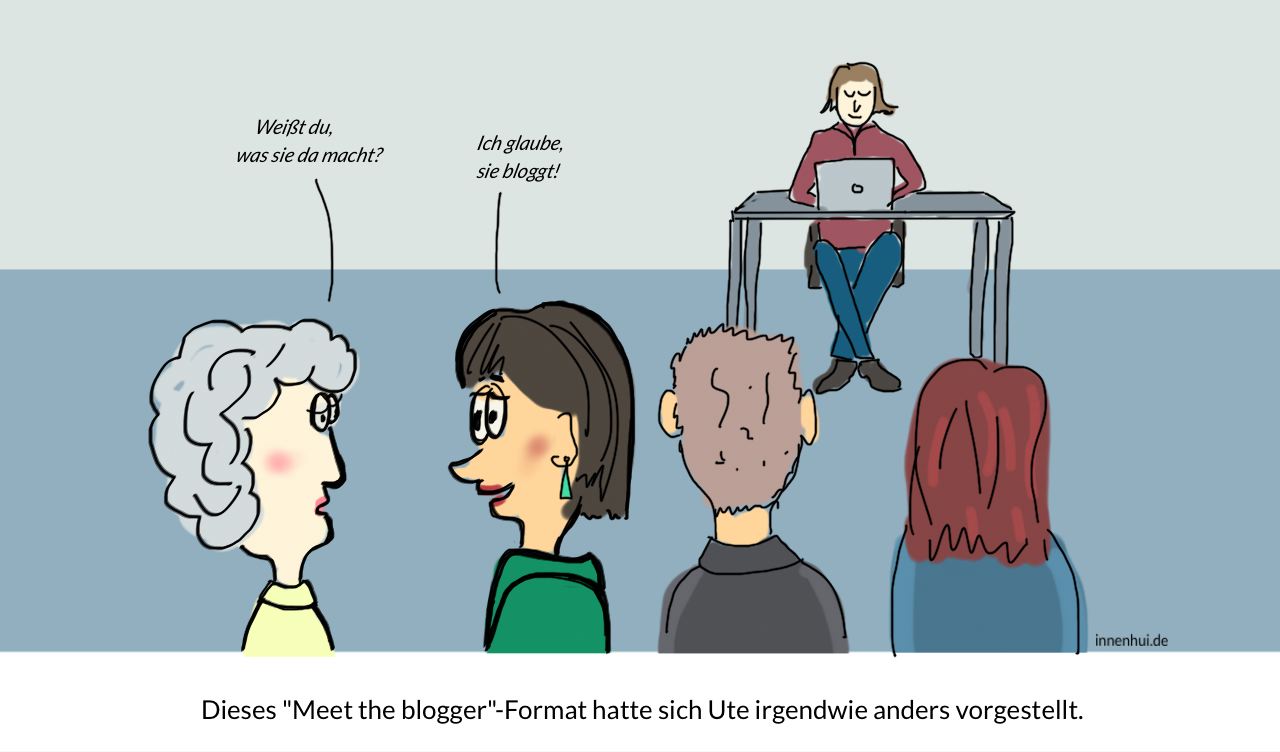
10. Dezember 2019, 09:24